
Ohne die erforderlichen Prozesse und Unternehmenskultur wird aus Lust auf Innovation schnell Frust.Foto: yurolaitsalbert stock.adobe.com
Wien. Fast alle Unternehmen setzen auf Innovation. Doch vieles davon ist nur Innovationstheater. Denn es fehlen die richtigen Prozesse. Alexander Osterwalder, ist einer der weltweit gefragtesten Innovationsberater, erklärte am Rand des "Global Drucker Forum" in Wien, warum so viele Unternehmen scheitern. So hält der 44jährige Schweizer es für absolut falsch, junge Leute in einen Inkubator zu schicken. Stattdessen rät er dem Top-Management, ein Drittel seiner Zeit für Innovation zu reservieren – und gescheiterte Experimente gut zu finden. Doch das müssen auch Investoren und Human Resources verstehen. Ein weiter Weg…
Alexander Osterwalder hat Karriere gemacht: Nach seinem Studium zum Magister Artium in Politikwissenschaften an der Universität Lausanne promovierte er dort bei Prof. Yves Pigneur im Bereich Management Information Systems. Im Rahmen seiner Dissertation entwickelte mit dem Business Model Canvas eine visuelle Methode zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, die inzwischen von mehr als fünf Millionen Praktikern weltweit eingesetzt wird. Dazu gehören führende globale Konzerne wie Adobe, Coca-Cola, 3M, Microsoft, SAP und die NASA.
2010 brachte er zusammen mit Prof. Pigneur das Handbuch "Business Model Generation" mit zahlreichen Praxis-Beispielen heraus. Im gleichen Jahr gründete er zusammen mit Alan Smith Strategyzer eine Innovations-Plattform mit Software, Online-Training und Innovations-Coaching in Zürich. 2015 erschien sein Buch "Value Proposition Design". Beide Bücher wurden inzwischen mehr als zwei Millionen Mal verkauft und sind in über 40 Sprachen verfügbar.
Alle sprechen von Innovation. Unternehmen suchen händeringend kreative Mitarbeiter und Sie behaupten, Innovation sei ein Karriere-Killer. Warum?
Ja leider. Wenn man etwas Neues macht, muss man experimentieren und Dinge ausprobieren. Das klappt nicht immer auf Anhieb. Aber es gibt nichts Schlimmeres für die eigene Karriere als zu sagen, ich habe etwas probiert und das hat nicht funktioniert. Wenn man wirklich Innovation betreiben will, muss man experimentieren, und dazu gehört es auch, öfter zu scheitern. Doch diesen Prozess gibt es in den Unternehmen bisher nicht.

Alexander Osterwalder hilft Unternehmen wie Coca Cola oder der NASA bei der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen.Foto: Daniel Pasche 2014
Also präsentieren Mitarbeiter ihre Idee so, als wäre es bereits bewiesen, dass sie funktioniert. Sie machen ihren Traum zur Wirklichkeit statt einzugestehen, dass es wahrscheinlicher ist, dass ihre Idee scheitert. Die Leistungskennzahlen der meisten Unternehmen sind nach wie vor auf Management und Ausführung ausgerichtet. Wenn ich etwas Neues ausprobiere und scheiterte, werde ich nicht dafür belohnt, sondern bestraft und gefährde meine Karriere.
Aber CEOs können nicht anders. Sie müssen ihre Kennzahlen erreichen und stehen dabei gegenüber de Eigentümern oder Aktionären in der Pflicht.
Man muss im Prinzip zwei Systeme mit unterschiedlichen Kulturen aufbauen. Einmal den bestehenden Bereich. Da muss ich als Manager meine Zahlen liefern. Wenn ich zwei Prozent Wachstum voraussage, muss ich die auch bringen. Gleichzeitig muss ich parallel eine Kultur schaffen, wo man experimentieren kann. Da wird nicht sofort gemessen, wie viel Geld die neue Idee bringt, sondern wie viele Ideen ich getestet habe, wie viel ich gelernt habe und wie viele Ideen ein echtes Potenzial haben. Dazu muss ich Beweise liefern. Dafür spreche ich z.B. mit 100 Kunden über meine Idee. 50 haben dafür ein Budget und 30 sind bereit, dafür zu zahlen.
Also brauche ich zwei getrennte Organisationen?
Ja, aber es muss so etwas wie eine durchlässige Membrane geben. Denn ein Grossunternehmen hat viele Ressourcen: die Marke, intellektuelles Eigentum und die Kunden. Wenn ich die beiden Systeme völlig trenne, fehlt mir als Innovator der Zugang zu diesen wichtigen Ressourcen. Das klingt sehr banal, ist es aber nicht. Wenn ich Key Account Manager bin, möchte ich nicht unbedingt, dass da jemand kommt und mit meinen Kunden über neue Produkte spricht. Denn dann kaufen sie vielleicht meine Produkte nicht mehr. Hier muss die Führung klare Zeichen setzen und z.B. vorgeben, dass 20 oder 30 Prozent des Wachstums von neuen Produkten kommen muss.
Das klingt so, als seien Manager und Innovatoren zwei ganz unterschiedliche Typen.
Manager und Innovator oder Entrepreneur sind zwei völlig unterschiedliche Berufe. Wenn ich Spass am Managen von existierenden Prozessen habe, bin ich eher guter Manager. Wenn ich gern viele neue Dinge anfange und ausprobiere, habe ich wahrscheinlich mehr Unternehmertum im Blut. Nur weil ich einen 5 Milliarden-Bereich gut gemanagt habe, bin ich noch lange nicht ein guter Unternehmer.
Also ist es auch eine Sache der Persönlichkeit?
Entrepreneure erkennt man auch daran, dass sie eine neue Idee auch dann anreissen, wenn von vornherein klar ist, dass sie zum Scheitern verurteilt ist. Sie haben einfach Lust am Ausprobieren und wenig Angst vor dem Scheitern. Und sie stehen viel schneller wieder auf. Da braucht man schon ein dickes Fell, muss viel einstecken und mit Unsicherheit umgehen können.
Ein Problem ist, dass Innovation oft verherrlicht wird. Gerade von jungen Leuten. Die wollen Entrepreneure werden, ohne zu realisieren, dass das ein knochenharter Job ist. Da müsste man noch viel mehr in der Ausbildung und an den Hochschulen tun. Dort sollte jeder etwa durch Projektarbeit im risikofreien Umfeld erfahren können, was es heisst, Unternehmer zu sein. Schliesslich ist das nicht für jeden das Richtige.

Viele Ideen aus den 'Inkubatoren' schaffen es nicht in die Umsetzung, da dem Management die Legitimation fehlt.Foto: Marvin Meyer Unsplash
Aber man hat häufig den Eindruck, dass heute jeder Mitarbeiter innovativ sein muss.
Es gibt verschiedene Typen von Innovationen. Einmal geht es darum, Prozesse zu verbessern. Das ist auch wichtig. Es muss immer auch Mitarbeiter geben, die die Sachen des bestehenden Geschäfts möglichst gut abarbeiten. Das ist schliesslich die Cash Cow. Und dann gibt es die Wachstums-Innovation. Das ist ein eigener Beruf. Es braucht also eine Partnerschaft zwischen Manager und Innovatoren oder Entrepreneuren. Man muss Weltklasse im Management und bei Innovationen sein. Das ist allerdings schwierig.
Inzwischen hat fast jedes Unternehmen einen Inkubator, in dem meist junge Leute in flippigen Räumen sitzen und neue Ideen kreieren sollen. Ist das der richtige Weg?
Das ist für mich fast immer Innovationstheater. Mitarbeiter, die Innovation betreiben, sollten keine jungen und unerfahrenen Mitarbeiter sein. Wenn man sich die Startups anschaut, dann sind die erfolgreichen Unternehmer oft 40 Jahre oder älter. Das vor allem der junge Stanford-Abbrecher eine riesige Firma kreiert, ist ein Klischee, das nur selten der Wahrheit entspricht.
Aber Inkubatoren bieten doch den Spielraum, etwas Neues auszuprobieren. Das kann doch nicht falsch sein.
Was fehlt, ist oft die Legitimation der Spitze, dass wirklich Innovation betrieben werden soll. Wenn der CEO und das Top-Management nicht 20 bis 30 Prozent ihrer Zeit mit Innovation beschäftigt sind, also sich mit Innovationsteams und potentiellen Kunden für neue Produkte austauschen, ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass niemand im Unternehmen Innovation ernst nimmt.
Das grösste Problem ist für mich Macht. Innovation hat heute im Unternehmen weder Macht noch Legitimation und darum sind die meisten Inkubatoren auch Quatsch. Im Inkubator eines Unternehmens, das von Management und Ausführung dominiert wird, entstehen zwar manchmal auch neue Ideen raus, aber die schaffen es nicht nach oben. Die Aktivitäten müssen strategisch integriert sein. Und das Management muss sich damit beschäftigen.
Ist das den jungen Leuten, die in einen Inkubator gehen, bewusst?
Die haben keine Ahnung. In Inkubatoren wird viel Energie verschwendet und oft merken sie erst nach drei Jahren, dass Innovation im Unternehmen gar nicht so ernst genommen wird. Ich sehe viele, die in einen firmeninternen Inkubator gehen. Dann sind sie frustriert und wechseln zur Konkurrenz. Dort merken sie, dass es genauso läuft. Schliesslich versuchen sie es selbst und verlassen das Unternehmen. Das ist ein Riesenproblem, weil die Unternehmen so ihre besten Talente verlieren. Bill Fischer von der IMD Business School in Lausanne sagt immer, wir kämpfen erfolgreich um die besten Talente und dann machen wir sie zu mittelmässigen Mitarbeitern. Das ist wirklich ein Witz.

Alexander Osterwalder: Manager und Innovatoren sind zwei völlig unterschiedliche Berufe.Foto: privat
Woran erkenne ich als Mitarbeiter, ob ein Unternehmen Innovation ernst nimmt?
Der erste Punkt ist, wie viel Zeit das Top-Management mit Innovation verbringt. Aber zu den Informationen hat man nicht immer Zugang. Wer in einem neuen Innovationsteam arbeiten will, sollte dem Teamleiter die Frage stellen: Wie viel Zeit bekommst Du vom Top-Management? Und wenn er diese Person nicht wöchentlich trifft, hat Innovation keinen Platz in diesem Unternehmen.
Oder ich schaue mir die letzten vier wichtigen Management-Meetings an. Wenn auf der Agenda nirgends das Thema Innovation steht, ist es nur ein Lippenbekenntnis. Innovation wird nicht top-down definiert, sondern legitimiert. Die Ideen kommen bottom-up, aber wenn der entsprechende Kontext und die Konditionen nicht von oben kreiert werden, kommt man als Innovator nicht auf einen grünen Zweig.
Welche Rolle spielt HR dabei?
HR spielt eine grosse Rolle, vor allem weil Manager und Innovatoren ganz unterschiedliche Fähigkeiten brauchen. Das muss erst einmal breitflächig im Unternehmen bekannt gemacht werden. Bis zu einem gewissen Grad müssen heute alle Mitarbeiter lernen, zu experimentieren, um das bestehende Geschäft besser zu machen. Dabei könnte HR eine grosse Rolle spielen, um dieses Denken ins Unternehmen reinzubringen. Da tut HR noch nicht genug. Und es braucht Veränderungen bei der Beurteilung von Mitarbeitern.
Inwiefern?
Je nachdem, was der Mitarbeiter macht, muss er anders bewertet werden. Wenn ich als Supply Chain-Manager für eine Produktlinie zuständig bin, ist Scheitern natürlich nicht unbedingt so gefragt. Als Innovator müsste ich dagegen belohnt werden, wenn ich zwar gescheitert bin, aber daraus gelernt habe. So erklärt Amazon-Chef Jeff Bezos immer, dass Amazon der beste Platz zum Scheitern ist. Vor allem muss HR erst mal verstehen, was Innovation ist und bedeutet. Das ist leider nur sehr selten der Fall. Da gibt es viele Mythen.
Zum Beispiel welche?
Ein Mythos ist, dass es nur die richtige Person und die richtige Idee braucht, dann klappt alles. Das ist Quatsch. Ideen gibt es überall. Und alle Unternehmen haben auch kreative Mitarbeiter. Wirklich schwierig ist es, eine Idee in ein Wertversprechen zu verwandeln, das die Kunden wollen. Dafür muss ich experimentieren. Ich brauche also kein Genie, sondern die richtigen Prozesse. Da kann HR sehr viel mithelfen.
Aber das Experimentieren kostet viel Geld.
Das ist auch wieder so Mythos. Viele glauben, Innovationen sind teuer und risikoreich. Aber das ist nur der Fall, wenn ich es falsch mache. Wenn ich eine Idee habe, muss ich diese schnell und billig testen. Also spreche ich mit Kunden. Erst wenn ich weiss, dass die Idee ein echtes Potenzial hat, kann ich mehr investieren. Das heisst, am Anfang ist Innovation nicht teuer. Erst wenn ich skaliere, brauche ich mehr Geld. Aber dann sollte ich auch wissen, dass die Erfolgsaussicht gut ist.
Sie nennen immer wieder Amazon als Vorzeige-Beispiel. Gibt denn auch noch andere Unternehmen, die so agieren?
Vielleicht noch Adobe oder Netflix. Aber auch Bayer und Bosch sind meiner Meinung auf einem guten Weg. Die haben jedes Jahr in 40 bis 60 Teams, die drei Monate lang Ideen testen. Nach drei Monaten investieren sie ungefähr in ein Drittel der Ideen. Nur die mit dem besten Potenzial bekommen Geld. Denn man muss sich einfach klar machen: Sieben von zehn neuen Produkten scheitern. Und um ein milliardenschweres Geschäft zu etablieren, braucht es mindestens 250 Projekte.
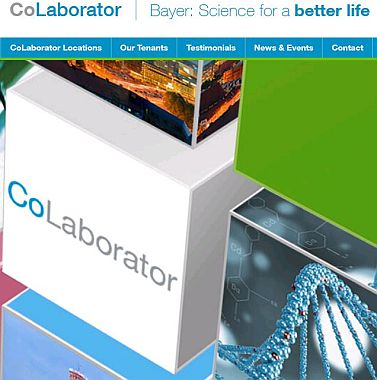
Die CoLaborators – Forschungs-Inkubatoren für Startups – sind Teil von Bayers Innovations-Strategie.
Vor allem US-Firmen stehen stark unter dem Druck der Aktionäre. Akzeptieren diese denn das Scheitern?
Das ist auch wieder so ein Missverständnis. Natürlich muss man Wachstum liefern, aber gleichzeitig auch experimentieren. Die Aktionäre wollen beides sehen. Dabei darf man nie das Kerngeschäft vernachlässigen. Denn das muss das Geld generieren, das ich in Innovationen investiere. Amazon verteilt daher seine Gewinne nicht und kauft keine Aktien zurück, sondern investiert sie in neue Produkte. Die meisten Unternehmen kaufen dagegen Aktien zurück oder machen unsinnige Akquisitionen.
Warum unsinnig?
Meist fehlt die strategische Vision. Amazon war ein eCommerce-Einzelhändler, der Bücher verkauft hat. Dann haben sie angefangen, Webservices an andere Unternehmen zu verkaufen. Das klingt erst mal verrückt. Aber Jeff Bezos hat eine klare Vision: Wir investieren in Wachstumsbereiche, wenn zwei Konditionen zutreffen: Einerseits muss es eine starke Synergie mit unserem bestehenden Geschäft geben. Das war bei Webservices der Fall. Und zudem muss das neue Geschäft mindestens so gross werden können wie das bestehende. Auch das hat geklappt.
Jedes Unternehmen braucht daher eine Vision, damit es weiss, in was es investiert und in was nicht. Man muss das Spielfeld abgrenzen. Was ist drinnen und was ist draussen. Dabei geht es nicht nur um Geld, sondern auch darum, welche neuen Ideen meine Teams ausprobieren sollen. Doch das fehlt in den meisten grossen Unternehmen.
Können Akquisitionen eigene Innovationen ersetzen?
Wenn ich etwas kaufe, bin ich natürlich schneller. Das kann manchmal richtig sein. Aber es ist schlecht, wenn Zukäufe mein einziges Mittel sind, weil ich selbst nichts Neues kreieren kann. Ich brauche die ganze Palette.
Innovationen werden meist mit den neuesten Technologien verbunden. Sind sie letztlich der Schlüssel zum Erfolg?
Das ist ein weiterer Mythos. Innovation bedeutet nicht unbedingt, die neueste Technologie einzusetzen. Ich kann auch mit minderwertiger Technologie gewinnen. Ein Beispiel ist Nintendo mit seiner Wii Konsole. Die war technologisch schlechter als alles, was damals auf dem Markt war. Aber sie haben ein anderes Kundensegment anvisiert und zwar die Gelegenheitsspieler, die vor allem Spass haben wollten. Und für die war die Motion Control, mit der man Bewegungen kontrollieren und Tennis spielen kann, ein echter Gewinn.
Es geht also in erster Linie immer um Schaffung von Wert für den Kunden und fürs Unternehmen. Dabei kann die neueste Technologie eine Rolle spielen, muss aber nicht. So könnten die Banken sehr viel Wert kreieren, wenn sie sich endlich mal auf den Kunden ausrichten würden und nicht immer nur auf die Technologie schauen.
Unternehmen wie Amazon oder Apple lassen sich heute nicht mehr eindeutig einer Branche zuordnen. Verschwinden die Grenzen zwischen Branchen und Industrien künftig immer mehr?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Apple verkauft Soft- und Hardware, ist Content-Provider und im Einzelhandel tätig. Aber die meisten Unternehmen denken noch immer in Branchen-Kategorien. Doch das ist überholt und Unternehmen, die das nicht erkennen, werden nicht überleben.
Die typische Panikmache von Beratern, um das eigene Geschäft zu beflügeln?
Die Situation hat sich schon gravierend geändert. Früher genügte es, in der Abwicklung seines Geschäfts besser als die Konkurrenz zu sein. Heute reicht das gerade noch, um zu überleben. Ohne zusätzliche Innovation ist die Zukunft eines Unternehmens ungewiss.
Das klingt beängstigend. Was ist Ihre Prognose?
Ich bin eigentlich sehr positiv. Die ersten Unternehmen machen die richtigen Schritte und ich bin ganz zuversichtlich, dass einige Konzerne überleben werden. Beim Global Drucker Forum in Wien meinte jemand nonchalant, vielleicht sei der Lebenszyklus der Gross-Unternehmen einfach vorbei. Das kann ich nicht so akzeptieren. Denn dafür sind die menschlichen Kosten zu gross. Wenn ein Unternehmen mehrere 10.000 Mitarbeiter entlassen muss, ist das eine enorme Belastung für die Kommunen. Ich möchte daher den Unternehmen helfen und sie anspornen, mehr und vor allem richtig in Innovationen zu investieren. Das ist für mich auch eine moralische Verpflichtung.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Herr Osterwalder!
Das Interview führte Bärbel Schwertfeger.
